Mit dem kürzlich verabschiedeten Bauturbo will die Bundesregierung erreichen, dass schneller und flexibler gebaut werden kann. Sie will Bürokratie abbauen und Erleichterungen schaffen. All diese Maßnahmen sollen den Wohnungsbau beschleunigen. Ob sie das tatsächlich bewirken, hängt allerdings von den Kommunen ab. Sie entscheiden, ob und inwieweit sie den Bauturbo auf ihrem Gemeindegebiet zünden lassen.
Bauturbo > Trägheit?
Es wäre nicht überraschend, wenn der Bauturbo an den üblichen Hürden verhungerte, die schon so manche „Ansage von oben“ zum Scheitern oder Verzweifeln brachten:
- Viele Bauämter verzeichnen Personalmangel und arbeiten digital noch im letzten Jahrhundert.
- Viele Bauträger sind noch dabei die Wunden der jüngsten Vergangenheit zu lecken und nicht bereit für umfangreiches Umdenken und Modernisieren
- In Kommunen verschleppen Einsprüche oder Bürgerinitiativen den Bau neuer Einrichtungen, Wohngebiete etc. – Bauen ja, aber nicht vor meiner Haustür!
Es wird eine Entscheidung getroffen und danach dürfen alle nochmal überlegen, ob sie mitmachen wollen. Das ist ein wiederkehrendes Muster im demokratischen Föderalismus – zumindest so wie wir ihn in den letzten Jahren leben.
Energie, Mobilität, Rente, Gesundheit und Pflege, Bildung, Verteidigung… Wir diskutieren alle Themen bis ins letzte Detail, wollen es allen recht machen und ja nicht zu viel fordern, ja keine Einschränkungen oder Verzichte verlangen. Natürlicherweise können wir damit nicht zu klaren Entscheidungen kommen und schon gar nicht zu einer konsequenten Umsetzung derselbigen.
Kettensägen gegen Bürokratie?
Vielleicht ist der demokratische Föderalismus nicht mehr die richtige Staatsform im schnellen und radikalen Wandel unserer Welt? Bis wir unsere Schuhbänder gebunden haben, sind Chinesen und Amerikaner schon im Ziel. Sie wirken schneller, dynamischer und bald uneinholbar. Könnte uns eine Kettensäge à la Milei Beine machen? Eine zentrale Macht, die den bürokratischen Dschungel freischlägt? Der Gedanke scheint angesichts der endlosen Diskussionen verlockend, aber bei genauerem Hinschauen doch gefährlich.
Eine Kettensägen-Revolution kann vielleicht dort wirksamer sein, wo viele Leute etwas zu gewinnen haben und die wenigsten etwas zu verlieren. Bei uns in Deutschland ist es umgekehrt. Unser System wird getragen von vielen, die sich eine ordentliche Existenz aufgebaut haben. Unser System hat bewiesen, dass es Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit und Wohlstand verbinden kann.
Bei uns ist die Mannschaft der Star
Wenn unser System heute nicht mehr die gleiche Kraft entfachen kann wie beispielsweise in den Boomjahren, dann liegt das vor allem an den Beteiligten – an uns allen (und nicht an Trump, China, der Ukraine, Putin oder Netanjahu….). Das beste System kann nur so gut funktionieren, wie die Spieler es umsetzen. In den letzten Jahren scheinen wir den Ernst des Spiels vergessen zu haben:
- Wir haben unsere Positionen aufgegeben
- Unser Fitnesszustand ist bedenklich
- Unsere Laufwege stimmen hinten und vorne nicht mehr
- Disziplin? Fehlanzeige!
- Wir haben das gemeinsame Ziel aus den Augen verloren
Auf den Bauturbo gemünzt könnte das bedeuten:
- Die Regierung entscheidet, die Kommunen setzen um
- Alle Beteiligten bringen sich auf zeitgemäßes Leistungsniveau und Tempo
- Bauämter und Bauträger optimieren ihre Prozesse nach einheitlichen Mindestvorgaben
- Wer wiederholt aus der Reihe tanzt oder nörgelt, wird ausgewechselt
- Ziel ist, dass wir ab 2026 mindestens 400.000 Wohnungen p.a. bauen.
Wenn wir wieder lernen, so konsequent zu agieren, dann werden auch die Nörgeleien auf den Zuschauerrängen aufhören. Momentan kann man Verständnis haben für deren Proteste, Pfeifkonzerte und unzählige unqualifizierte Kommentare in den sozialen Medien.
Das Gras ist grüner auf unserer Seite
So frustrierend die Performance unseres Staates und unserer Gesellschaft mitunter sein mag: Unsere Defizite liegen nicht im demokratischen Föderalismus begründet. Das ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein Schutzmechanismus. Er schützt uns vor Machtmissbrauch, vor blinder Gefolgschaft und vor Kurzschlussentscheidungen mit Langzeitschäden.
Autokratische Systeme mögen schneller sein – aber sie führen oft schnell zum falschen Ergebnis. Deren gern gerühmte Effizienz basiert häufig auf Angst statt Einsicht, Durchgriff statt Dialog, Gehorsam statt Kompetenz.
Unser System ist langsamer, ja – aber es ist robuster, glaubwürdiger, menschlicher. Es braucht keine Revolution mit der Kettensäge. Aber es braucht Entscheidungsfreude, Führungsverantwortung und die Bereitschaft, die eigene Rolle und Aufgabe ernst zu nehmen – auf allen Ebenen.
Wenn wir unsere Qualitäten wieder auf den Platz bringen und unser demokratischer Föderalismus wieder ins Rollen kommt, wenn wir wieder diszipliniert und konsequent gemeinsame Ziele verfolgen, dann schlagen wir jede Autokratie aus dem Feld – nicht nur moralisch, sondern auch strategisch.
 Foto von
Foto von 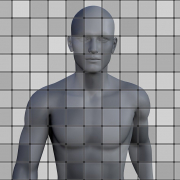 Bild von
Bild von 
 ChatGPT-Thomas Bily
ChatGPT-Thomas Bily

 Image by
Image by 

