„Der demographische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich: Die Lebensarbeitszeit muss steigen“, meinte Wirtschaftsministerin Reiche Ende Juli. Wenn wir wie gewohnt weiter arbeiten wollen, dann liegt Frau Reichert mit ihrer Aussage wohl richtig. Aber es könnte ja auch sein, dass wir uns aufraffen und endlich die Chancen der Digitalisierung besser nutzen.
Das obige Plakat hing 2020 in den Straßen von München. Ein Jahr davor hatte ich in meinem Buch Marketing im demografischen und digitalen Wandel geschrieben:
Die Zukunft der Arbeitswelt wird vom demografischen und digitalen Wandel profitieren. Künstliche Intelligenz wird nicht nur Prozesse effizienter gestalten, sondern auch enge Arbeitsmärkte überbrücken helfen. Digitale Kommunikation wird das Wissen älterer Generationen lange für Unternehmen nutzbar machen. Ausschlaggebende Kriterien für die Arbeitsplatzwahl werden Freiheit und Teilhabe am Unternehmen sein. Strenge Hierarchien sind Auslaufmodelle. Gleichberechtigung wird es nicht nur in der Geschlechterfrage geben.
Wir Deutsche sind seitdem, natürlich, ein Stück älter geworden. Jungen Zuwanderern ist es zu verdanken, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung stabil bleibt.
Recht viel digitaler sind wir in den letzten Jahren leider nicht geworden. Nicht einmal Covid hat eine nachhaltige Digitalisierungswelle auslösen können. Vereinzelte Strohfeuer wie Home-Office oder E-Rezept können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland nach wie vor am digitalen Stock geht – vor allem die Älteren, vor allem auf dem Land. Eine passive, mitunter reaktionäre Haltung lähmt unser Land. Mit jedem verpassten Jahr wird es schwieriger und kostspieliger, dass wir uns daraus befreien und wieder agil und wettbewerbsfähig werden.
Langzeiteffekt der Nicht-Digitalisierung
Es geht nicht nur darum, dass viele Prozesse in Ämtern, Behörden oder Unternehmen – vor allem im öffentlichen Sektor – dringend digitalisiert werden müssten. Das viel schwerer wiegende und tiefer sitzende Problem ist, dass im Zuge der jahrelangen Stagnation und Ignoranz eine fatal falsche Allokation der Ressourcen erfolgte. Es wurden Berufsbilder aufrecht erhalten, die es schon lange in der Form nicht mehr geben dürfte. Das führte dazu, dass falsche Anforderungen in den Arbeitsmarkt adressiert wurden. Aufgrund dieser strukturellen Fehlsteuerung landeten fehlqualifizierte Bewerber in Berufen mit geringer Zukunftsfähigkeit. So als würde man lahme Gäule für ein Rennen in der Abrissarena trainieren, wo sie im altgewohnten Trab dahin trotten dürften. Und nebenan, wo Tempo und Zukunft gemacht werden, fehlen hinten und vorne qualifizierte Arbeitskräfte.
Engpass Konsequenz
Wir sind in Zeiten des Wandels. Es gibt viel zu tun. Die meisten Veränderungen sind nicht schwer, aber wir müssen sie schnell und konsequent angehen. Und genau daran hakt es: an der Konsequenz. Jeder wird gefragt nach seiner Meinung: zu bargeldlosem Bezahlen, zu E-Mobilität, zu E-Rezept und E-Government, KI gut oder böse und so weiter.
- Ein aktuelles Beispiel: Die Verwaltung in Bayern stöhnt unter hoher Belastung und gleichzeitig tüfteln Landkreise und Gemeinden an eigenen digitalen Lösungen. Konsequent wäre eine Vorgabe der Staatsregierung, dass alle ab sofort einen gemeinsamen Weg der Digitalisierung gehen (siehe Artikel der Süddeutschen Zeitung. Das Bewusstsein dafür ist seit Jahren da, sogar in der CSU. Siehe das Plakat als Titelbild dieses Beitrags aus 2020. Es fehlt an der Konsequenz in der Umsetzung.
Wo kauf ich dann mein Bahnticket?
Wir dürfen nicht auf die warten, die nicht wollen – die aus Prinzip, Bequemlichkeit oder Widerstand gegen Neues alles blockieren, obwohl sie könnten. Gleichzeitig müssen wir jenen helfen, die wollen aber nicht können: Menschen, denen digitale Bildung, Zugang oder Selbstvertrauen fehlt. Sie brauchen unsere Unterstützung – gezielt, geduldig, pragmatisch. Doch wir dürfen die Geschwindigkeit des Fortschritts nicht nach den Bremsern ausrichten. Wer mitwill, ist willkommen. Wer nicht will, darf uns nicht mehr aufhalten.
Wir müssen die Wege nicht neu entdecken. Andere Länder sind schon vorausgegangen. Wir müssen nur folgen. Ab und an gelingt uns das ja. In der Münchner SAP Arena gibt es kein Bargeld mehr und ich habe dort keinen Boomer gesehen, der vor dem Chicken Wings Stand verhungert wäre. Alle zahlen anstandslos Bier und Burger mit Karte. Auch das Deutschland-Ticket ist ein Beweis für die digitale Breiten-Fitness der deutschen Bevölkerung.:Über 13 Millionen nutzen das Ticket, das es nur digital zu kaufen gibt.
Aber es geht noch viel, viel filigraner: Vor kurzem war ich im Urlaub in der ländlichen französischen Provence. Auf jedem Dorfmarkt kann man die Trüffelsalami mit Karte zahlen und in jeder Brasserie den halben Liter Rosé und die 12 Schnecken. In der Schweiz gibt es auf jedem Parkplatz Ladesäulen für Elektromobile. In jedem Eck der Schweiz ist der Empfang auf 5G. In Italien sowieso.
Und die nächsten sechs Jahre?
Eigentlich könnte ich mit dem o.g. Text aus 2019 antworten. Aber ich hoffe sehr, dass wir 2031 das Stadium der Erkenntnis hinter uns gelassen haben und schon weit gekommen sein werden auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen Staat mit einer dynamischen Gesellschaft.
Meine optimistische Prognose lautet: 2031 ist die Verwaltung in Deutschland weitestgehend digitalisiert! Vom Reisepass bis zu Baugenehmigung dauert jeder Behördenprozess maximal 2 Tage. Alle Zahlungen, Abrechnungen, Finanzbescheide und Steuererklärungen erfolgen digital. Digitale Gesundheitsakten begleiten uns durchs Leben und erlauben Ärzten erfolgreiche Ferndiagnosen mit KI-Support und automatische Medikamentenlieferung. Unser Land wird fast zu 100% Versorgung mit erneuerbaren Energien versorgt, die uns Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Immer mehr qualifizierte Menschen wollen in Deutschland arbeiten, weil unser Land für eine moderne Arbeitswelt und eine weltoffene Gesellschaft steht.
Das ist fast zu schön, um wahr zu werden.



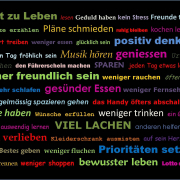 anncapictures pixapay
anncapictures pixapay